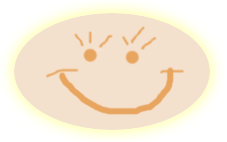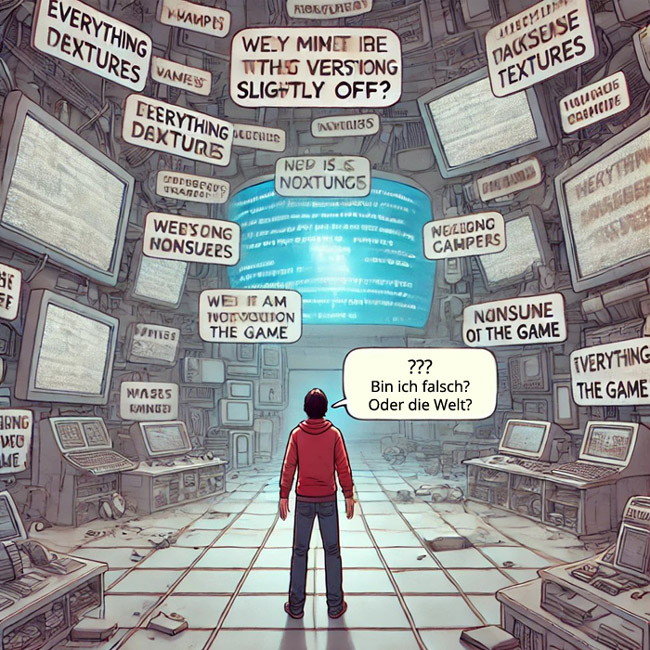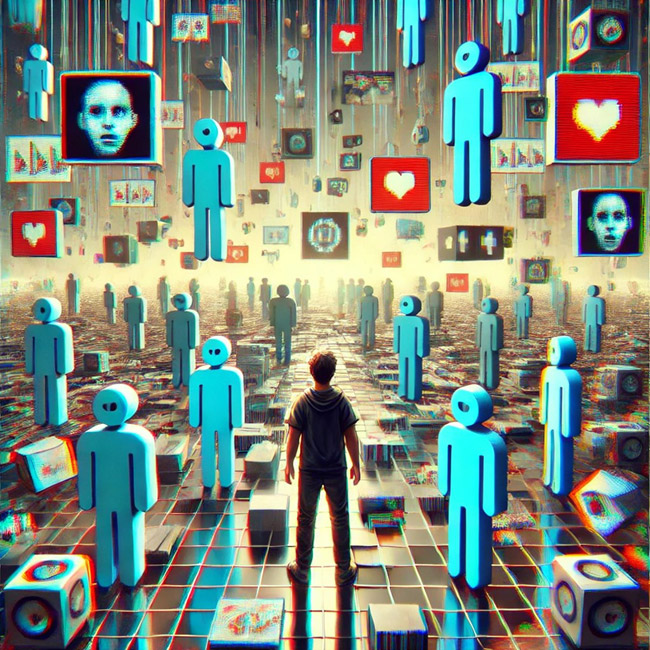Unter fast jeder Nachricht über einen Täter mit psychischer Erkrankung tauchen Kommentare auf wie:
„Sollen sie doch alle wegsperren, dann passiert nichts mehr!“
„Früher gab’s sowas nicht, heute hat ja jeder was.“
„Die wollen sich doch eh nur vor der Strafe drücken!“
Dieser Denkweise liegt ein gefährliches Missverständnis zugrunde.
Psychische Erkrankung =/= gefährlich.
Siehe oben…
Psychische Erkrankung =/= Schuldunfähigkeit.
Nur weil jemand Depressionen hat, bedeutet das nicht, dass er für eine Tat nicht zur Verantwortung gezogen wird. Genauso wie ein Diabetiker für einen Mord verurteilt wird, auch wenn er zum Tatzeitpunkt unterzuckert war.
Und die Forderung, alle wegzusperren?
Cool. Dann brauchen wir mehr Platz.
Etwa ein Viertel der Bevölkerung leidet irgendwann im Leben an einer psychischen Erkrankung. Das wären Millionen Menschen. Tendenz steigend!Weil psychische Erkrankungen mittlerweile öfter diagnostiziert werden bzw. überhaupt die Bereitschaft der Betroffnene gestiegen ist, darüber überhaupt zu reden. Und garantiert nicht, weil es eine „Modekrankheit“ ist. Also Hausärzte/-ärztinnen, das Personal in Kliniken und psychiatrischen Ambulanzen vergibt nicht einfach so ein „Etikett“, weil es so bequem ist, wie viele unterstellen. Meine Erfahrung sagt da etwas anderes.
Trotzdem: Wohin denn beim Wegperren mit all den Leuten? Vielleicht bauen wir einfach eine eigene Stadt dafür? Psychoville? Neurodivergentistan?
Ein weiteres Problem dieser Forderung:
Stigmatisierung führt zu weniger Hilfesuche.
Wenn jeder glaubt, dass psychisch Kranke gefährlich sind, dann wird sich niemand mehr trauen, offen zu sagen: „Mir geht’s nicht gut, ich brauche Hilfe.“ Statt Prävention gibt’s dann Verdrängung – bis es wirklich zu Problemen kommt. Suizide sind nur eine Konsequenz, oft schaffen es depressive Menschen z. B. auch gar nicht mehr, auf die Arbeit zu gehen. Folge? Arbeitslosigkeit! Eine Flucht in die Sucht ist ebenfalls eine mögliche Konseuenz.
Viele der Folgen sehen Außenstehende nicht.