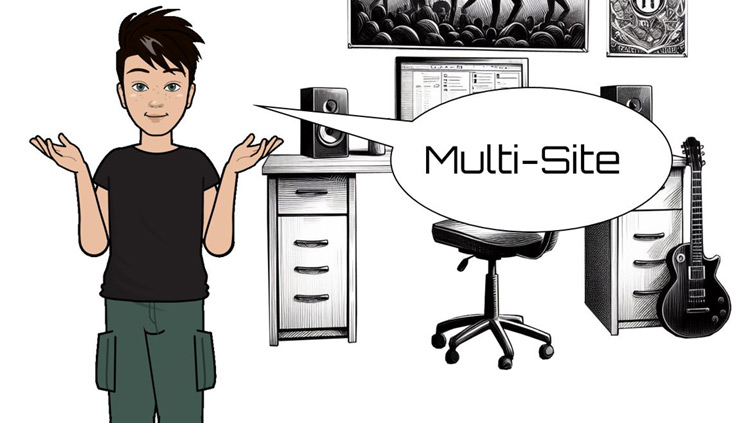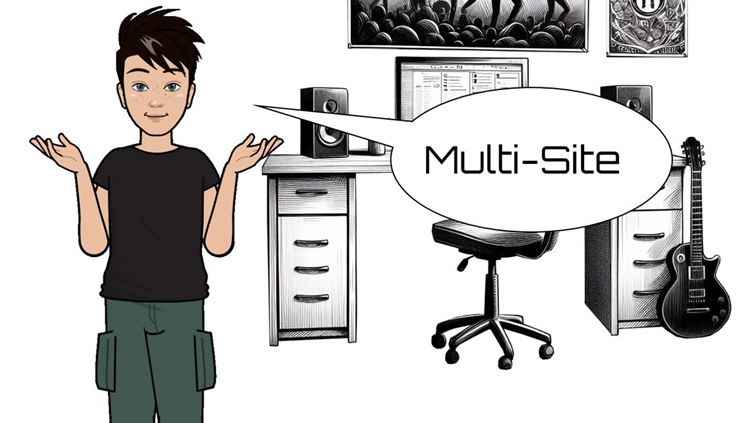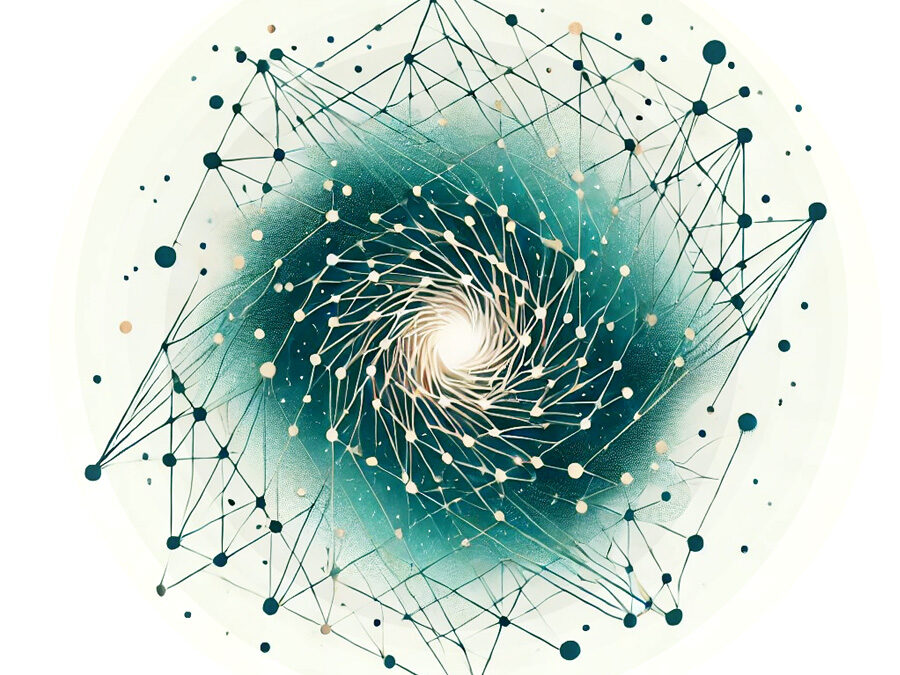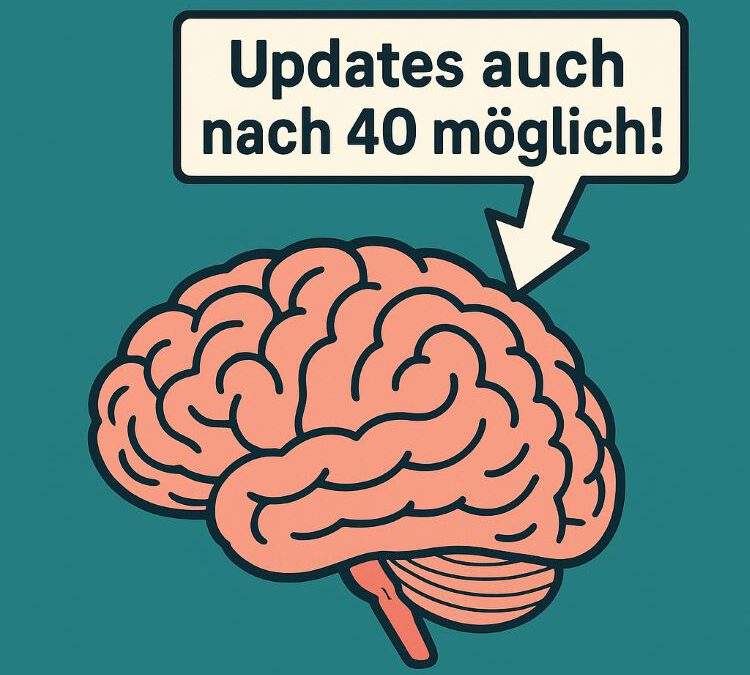
Lernen ab 40: Vorurteile nerven
Vorurteile ohne Nachfragen
Studium mit 40 beginnen, wie kann man nur freiwillig sowas machen? „Wurdest du gezwungen?“ „Musstest du das für den Job?“ Müssen, nein. Ich hätte genauso gut auch einfach nur weitermachen können wie bisher. Es war meine Entscheidung und Spoileralarm: Ich lerne gerne! Ich lerne gerne Neues, ich lerne gerne dazu, ich erweitere gerne mein Repertoire…
Für mich ist ein Stillstand wie ein vorzeitiger Abschied in den Komplettruhestand. Aber wenn du nicht sofort in den Sarg hüpfen willst, weshalb solltest du dann sowas freiwillig wollen?
(Und nein, ich spreche jetzt nicht davon, wenn du gerade ohnehin komplett überfordert mit all deinen Pflichten bist. Dass du dann Ruhe wünschst, ist nachvollziehbar und das einzig Richtige in diesem Moment.)
Was mir ebenfalls auffiel:
Warum gehen viele Menschen davon aus, dass man automatisch beim Lernen von den Jüngeren abgehängt wird? Und weshalb kommt dann gleich so ein: „Da packt man halt keine guten Noten mehr, gelle?“
Ist es neben der normalen Arbeit und das Studium beendet, kommt oft ein „War’s den Stress wert für so’ne miese Note?“, obwohl nicht mal nach der Note gefragt wurde.
Ich habe mein Studium in der von mir vorgesehenen Zeit durchgezogen und es war eher so, dass ich die Jüngeren abgehängt habe. Mir fiel allgemein auf, dass ältere Studierende viel strukturierter waren und meist dementsprechend überlegen bei der pünktlichen Abgabe ihrer Arbeiten, beim Lernen für die Prüfungen usw. Selbstverständlich kann mal das Leben dazwischen kommen, doch das ist bei jüngeren Studierenden ebenfalls so.
Also wenn jemand nicht lernen will, dann vielleicht doch wenigstens diese Kleinigkeit:
Lernen hat kein Verfallsdatum. Das Gehirn wird ab 40 nicht labbrig wie Toast in einem Regenschauer.
Was also steckt wirklich hinter solchen Sprüchen und Mutmaßungen?
Internalisierte Altersdiskriminierung!
Und die beginnt leider schon extrem früh.
Hier einige Gedanken, weshalb dieser Mist so weit verbreitet ist:
Die lineare Lebenslauf-Illusion
Viele Menschen glauben noch an die veraltete Formel: Kindheit → Ausbildung → Arbeit → Rente → Tod
Langweilig, aber funktionierte doch über Jahrzehnte. Über Jahrhunderte traue ich mich nicht zu sprechen, denn Kriege unterbrachen diese scheinbar beruhigende Abfolge, die eine gewisse Stabilität und Vorhersehbarkeit versprach.
Ein Studium mit 40 durchbricht dieses Narrativ. Wer das tut, zeigt: Man kann sich jederzeit neu erfinden.
Das ist beängstigend für jene, die sich mit ihrer eigenen Entscheidung abgefunden haben oder unbewusst spüren, dass sie es eigentlich auch gerne würden, aber sich nicht trauen. Außerdem: Hey, was würde dann alles auf uns zukommen wenn jeder einfach so nochmal irgendwann studieren würde? Am Ende gar als Rentner???
(Kleiner Hinweis am Rande:
Die „normalen“ Studierenden hatten kein Problem mit ihren älteren Kommiliton*innen. Die fanden das sogar sehr cool. Mehr Gegenwind gab es wohl von Menschen gleichen Alters.)
Die Abwertung („schlechte Note“) schützt das eigene Ego. Lohnt sich ja gar nicht, überhaupt etwas ändern zu wollen.
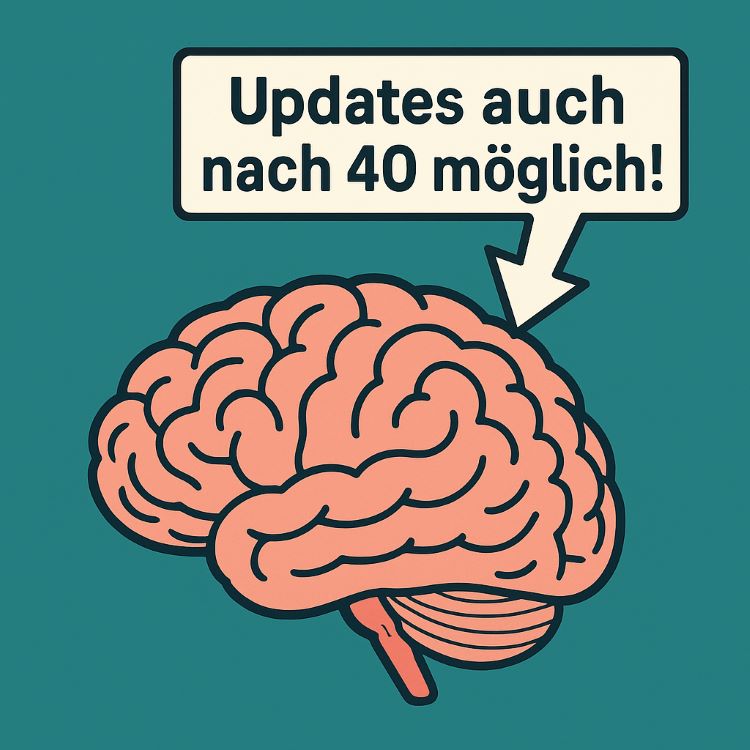
Wenn sich die Lebenswelt ändert?
Wenn das alte Narrativ nicht mehr stimmt?
Die Verklärung mit den Worten „Früher war alles besser!“ sowie Totalverweigerung des Fortschritts / Lernwillens bringt uns dann nicht weiter, sondern hilft nur irgendwelchen Populisten mit ihren einfachen „Lösungen“.
Lernen vs. Job: Warum das Quatsch ist
Die Idee, dass nur junge Menschen wirklich gut lernen können, stammt aus einem Bildungs- und Arbeitssystem, das Menschen wie Maschinen behandelt:
Lernfähig in jungen Jahren, dann verwertbar im Job. Meist sogar: nur für den Job später lernen.
Was bei Sprüchen wie „Was Hänschen nicht lernt…“ übersehen wird:
- Ältere haben oft bessere Zeitmanagement-Fähigkeiten, Erfahrung im Selbststudium und eine viel klarere Motivation.
- Ältere müssen vieles gar nicht komplett neu lernen, da sie an Wissen und Erfahrung anknüpfen können.
- Das Wissen wird dadurch verknüpfter, bleibt dann auch besser im Langzeitgedächtnis.
- Viele sind emotional stabiler und vergleichen sich weniger.
- Ältere wissen oft, wann „gut genug“ reicht, statt sich im Perfektionismus zu verheddern.
(Außer natürlich, sie sind Perfektionisten. Dann schützt das Alter auch nicht.)
Persönliche Weiterentwicklung? Bringt nix, angeblich. Den eigenen Interessen folgen? „Kannst du machen, wenn du Rentner bist.“ (Und dann heißt es: „Warum in dem Alter… blablabla“)
Dass Lernen allgemein unser Hirn fit hält, wird gerne übersehen. Dass wir es uns in unserer Berufswelt nicht leisten können, uns nicht weiterzuentwickeln, wird ebenso ignoriert.
Merke:
Lebenslanges Lernen bezieht sich nicht nur auf kurze Weiterbildungen, um weiterhin den Beruf ausüben zu können!
Unser Hirn will und muss immer mal wieder gefordert werden, sonst baut es viel schneller ab.
Spätstudierende gegen Spätzünderin
Sie wollte mir Tipps geben, wie ich mich besser im Studium organisiere, dabei war ich kurz vor der Bachelorarbeit innerhalb des Zeitraums, den ich mir gesetzt hatte(sogar dem Zeitraum etwa 1 Semester voraus). Sie hingegen war 2x in ihrem Nebenfach (machte auch einen Zweifach-Bachelor) bei einer Prüfung durchgefallen und brauchte als Vollzeitstudentin statt 3 Jahre 7 Jahre.
Sie wollte mir obendrein Lerntipps geben, fragte aber nicht mal, wie es überhaupt bei mir ausschaute. Meine schlechteste Note bei einer Prüfung war eine 3… Also vom Durchfallen weit entfernt. Ich musste auch keine einzige wiederholen.
Erst als ich sie darauf hinwies, dass ich ihr ja wohl eher hätte Tipps geben können, kam heraus, dass sie einfach mal so davon ausgegangen war, dass ich als Spätstudierende nicht wüsste, wie man überhaupt lernt.
Als langjährige Dozentin bei einem Bildungsträger, die sich auch vorher regelmäßig weiterbildete, wäre das allerdings sehr peinlich gewesen, oder?
Reminder:
Bevor du mit deinen Vorurteilen andere belästigst, frage doch einfach erst mal!
Und hinterfrage deine Vorannahmen, wenn du lernen willst.